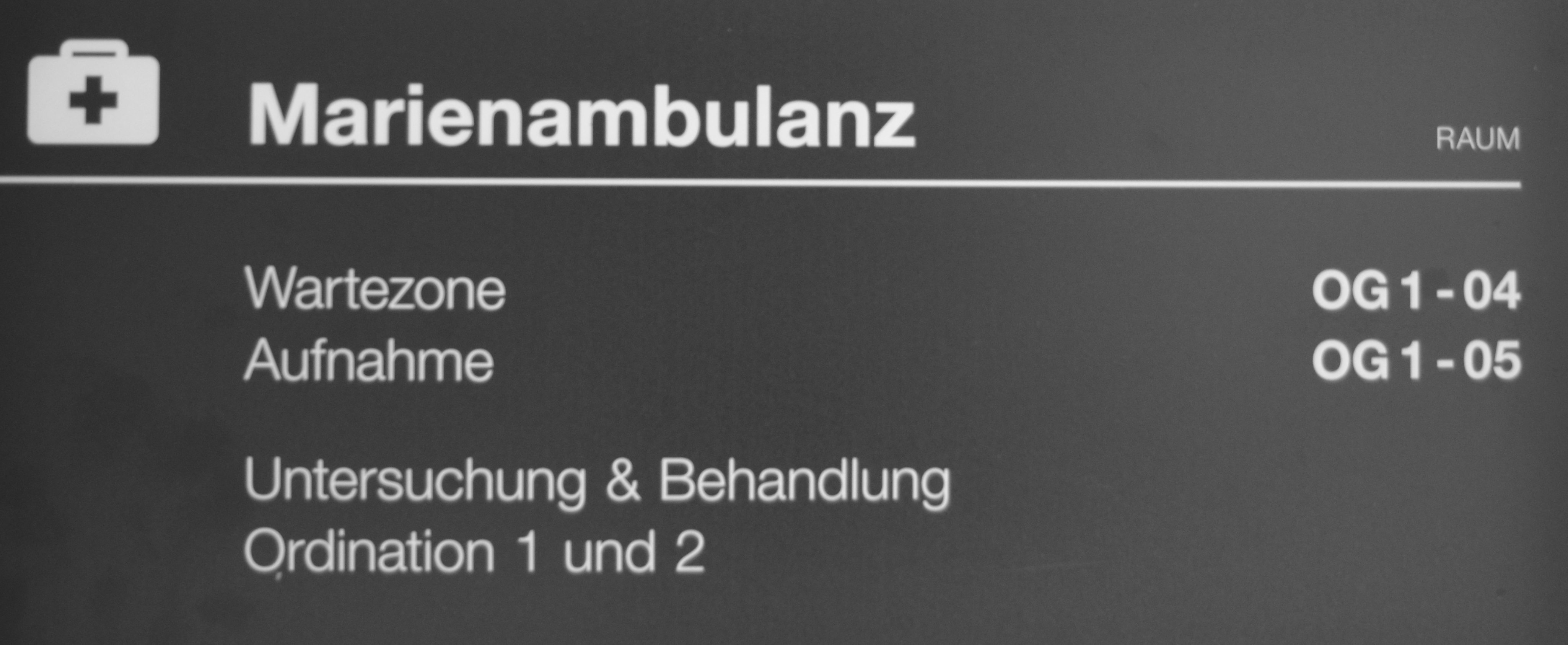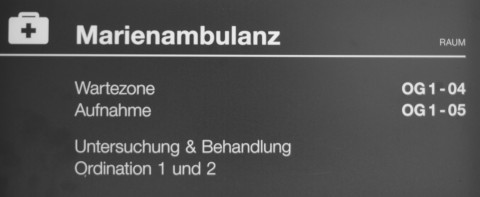Für die einen ist sie die erste Anlaufstelle in Not, für die anderen die letzte Chance: Eine Institution der Caritas bietet Hilfe, wenn das öffentliche Gesundheitssystem unerreichbar scheint.
Reger Austausch in verschiedenen Sprachen herrscht vor dem Gebäude in der Mariengasse. Es ist ein Dienstag, an dem wir die Marienambulanz besuchen. Der Wochentag, an dem die Frauensprechstunde angeboten wird. Im Wartezimmer haben bereits die ersten Patientinnen Platz genommen, eine davon hält ihr Kind im Arm. Es ist ein heller Raum, in dem wir uns befinden. Freundliche Gesichter empfangen uns in der Anmeldung. Die Frauen im Wartezimmer scheinen Arabisch zu sprechen, tauschen sich angeregt aus.
Die oftmals vorhandenen Sprachbarrieren sind nur ein Bruchteil der Probleme, derer sich die sieben Angestellten und knapp 40 freiwilligen MitarbeiterInnen in der Marienambulanz annehmen. Hierfür gibt es eigens einen Dolmetsch-Pool, in dem jedoch alle ehrenamtlich tätig sind. Zukünftig möchte sich die Leitung auch um eine Finanzierung kümmern. Denn 90 Prozent der PatientInnen sind ausländischer Herkunft, etwa die Hälfte davon AsylwerberInnen. Oft übersetzen Leute vom Dolmetsch-Institut, andere lernen die ÄrztInnen kennen, weil sie schon für diverse Einrichtungen übersetzt haben. So dolmetscht zum Beispiel jeden Dienstagvormittag eine Frau, die in Rumänien Medizin studiert, danach jedoch nie als Ärztin gearbeitet hat. Des Weiteren gibt es Ehrenamtliche für Russisch und Arabisch. Um Verständigungsschwierigkeiten schnell zu lösen, wird auch telefonisch übersetzt, wenn es nötig ist.
Knapp 1.700 PatientInnen nutzten im Jahr 2012 das Angebot der Caritas – und es werden laufend mehr. Manche wurden von anderen Caritas-Einrichtungen übermittelt, andere erfahren durch Mundpropaganda von der Organisation. Trotz mangelnder Deutschkenntnisse und kultureller Unterschiede soll jeder Patientin und jedem Patienten eine Behandlung gewährleistet werden. Deshalb ist es den MitarbeiterInnen besonders wichtig, geduldig zu sein und jeden in seiner körperlichen und geistigen Verfassung zu akzeptieren, wie er ist.
Oft sind es erst die Lebensumstände der Menschen, die sie überhaupt krank machen. „Wenn jemand im Auto schläft, wenn jemand gar kein Geld hat, wenn jemand nicht weiß, wo er wohnen soll, wenn jemand sich kein Essen kaufen kann – da kann man als Arzt nichts daran ändern“, erklärt Eva Czermak die oft schwierige Behandlung. Sie übernahm vor eineinhalb Jahren die organisatorische Leitung der Einrichtung, die erst 2012 in das neue Gebäude in der Mariengasse übersiedelte. In solchen Fällen versuche die Caritas zwar zu vermitteln, doch nicht immer könne auch geholfen werden.
Die Annahme, dass in Österreich aufgrund der Pflichtversicherung alle Menschen krankenversichert wären, ist falsch. Denn pflichtversichert sind nur im Inland selbstständig und unselbstständig erwerbstätige Personen sowie bestimmte Angehörige. Jene, die es sich leisten können, haben die Möglichkeit, durch eine freiwillige Krankenversicherung sozialen Schutz zu erwerben.
Für Menschen, die den Schritt in das normale Gesundheitssystem nicht schaffen, ist die Marienambulanz, die mit April 2014 ihr 15-jähriges Bestehen feiert, eine wichtige Anlaufstelle. Hier wird jeder behandelt. Auf Wunsch des Patienten bzw. der Patientin auch anonym.
Das Ziel der Behandlung ist es, Menschen (wieder) ins Gesundheitssystem einzugliedern. Dafür gibt es in der Marienambulanz eine Sozialarbeiterin, die alle Hilfesuchenden in Versicherungsangelegenheiten berät und begleitet. Doch auch viele Versicherte führt der Weg in die Marienambulanz, da sie die Kosten, die im normalen medizinischen System durch Selbstbehalte anfallen, nicht tragen können.
Die Institution erfüllt vor allem die Funktion eines Hausarztes. Ist eine spezielle Behandlung von Nöten, werden – auch nicht versicherte – PatientInnen an Fachärzte weiter überwiesen. Das ist möglich, da die Caritas Graz knapp 40 KooperationspartnerInnen hat, die sich bereit erklärt haben, eine bestimmte Anzahl von Kranken in ihrer Praxis kostenlos zu behandeln. Des Weiteren gibt es Kooperationen mit den Krankenhäusern der Barmherzigen Brüder und der Elisabethinen. Diese agieren im Fall von notwendigen Operationen. Ist die Vermittlung zu keinem der Kooperationspartner machbar, müssen die PatientInnen schlussendlich ins Landeskrankenhaus oder ins Unfallkrankenhaus, um behandelt zu werden. Dort bekommen sie jedoch anschließend eine Rechnung ausgestellt.
Eine besondere Problematik stellt die Geburtshilfe dar, die in der Marienambulanz nicht geleistet werden kann. „Wir versuchen den Frauen da wirklich nahezulegen, ihre Kinder im Heimatland zu bekommen. Die Rechnung hier beträgt oft mehrere Tausend Euro“, beschreibt Eva Czermak die Umstände. In Zahlen sind das bis zu 11.000 Euro. Gynäkologische Untersuchungen werden in der Ambulanz jedoch durchgeführt, besonders hier gibt es kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen: „Grundsätzlich kommt in der Frauensprechstunde alles Mögliche vor. Zum Beispiel, dass Frauen verhüten wollen, der Mann aber dagegen ist.“ Erst kürzlich musste eine Frau mit Begleiterinnen der Caritas in die Institution kommen, um ihre erste gynäkologische Untersuchung machen zu lassen, da ihr Mann das zu Hause verbiete.
Einrichtungen der Caritas wie die Marienambulanz sind nur dank der Mithilfe der vielen Ehrenamtlichen möglich. Einerseits sind das Ärzte und Ärztinnen, die für einige Stunden in der Woche PatientInnen behandeln, andererseits Menschen, die im organisatorischen Bereich mithelfen. Auf die Frage, ob die MitarbeiterInnen das Leid oft mit nach Hause nehmen würden, erhalten wir von Czermak folgende Antwort: „Man hat zu manchen Patienten schon eine persönliche Beziehung, aber ich glaube, alle die hier arbeiten, können gut damit umgehen. Ich glaube auch nicht, dass es für sie ein Problem ist, Privat- und Berufsleben zu trennen.“ Für die Menschen sei es nicht Leid, das sie mit nach Hause nehmen, sondern ein persönlicher Gewinn, da sie das was sie tun als sinnvoll empfinden.
Fotos: Lisa Klaffinger