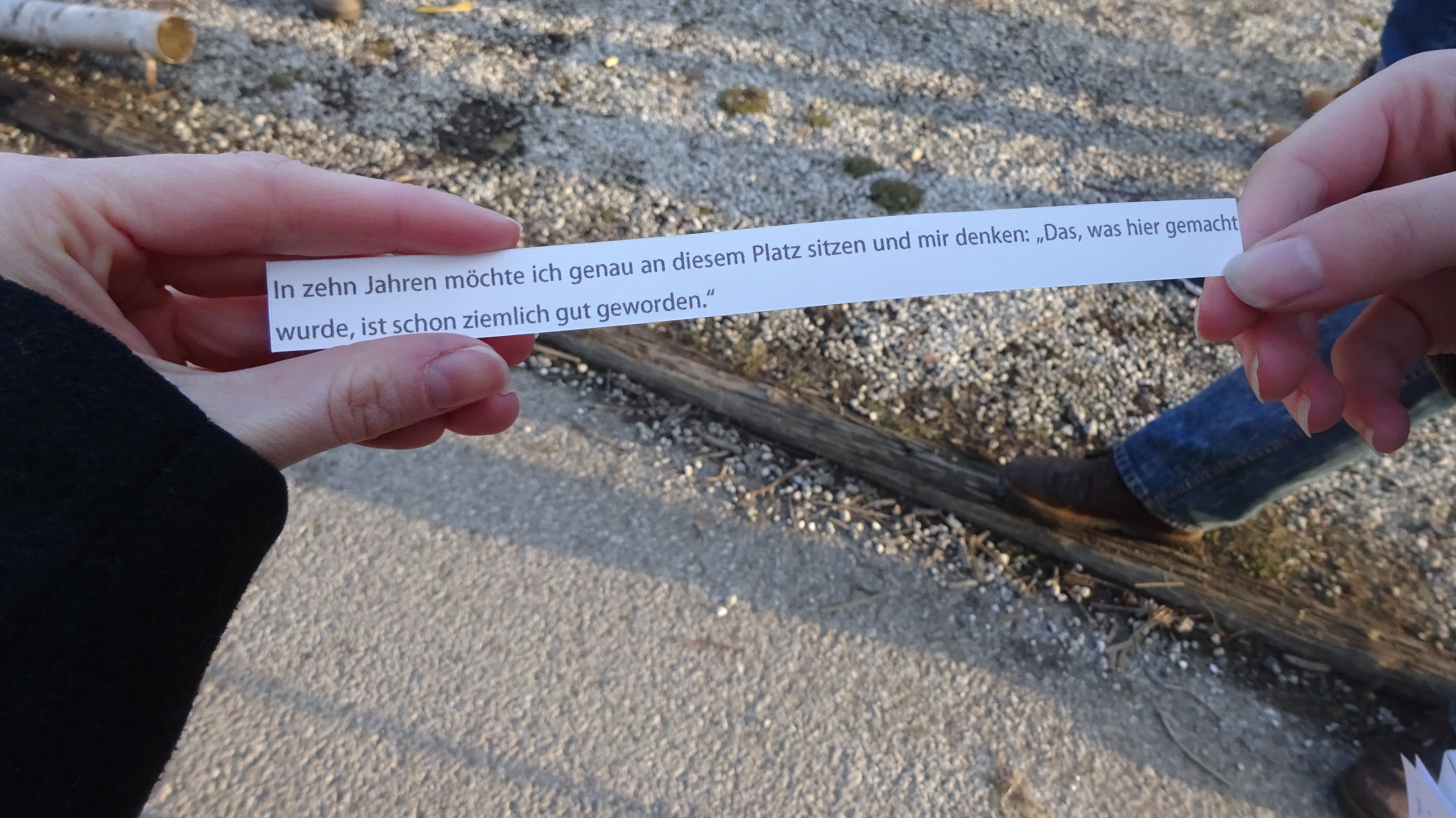Mit Jänner 2019 will die neue Regierung die Familienbeihilfe für Kinder aus dem Ausland kürzen. „Einen Schritt zur Gerechtigkeit” nannte Kanzler Sebastian Kurz das Anfang dieses Jahres. Frau Periček, die eine alte Frau im Annenviertel betreut, will dann aber nicht mehr nach Österreich kommen. Droht ein Pflegenotstand?
Brigita Peričeks Arbeitsplatz ist im sechsten Stock eines Hochhauses, in einer kleinen Wohnung mit schweren Teppichen und Landschaftsgemälden an den Wänden. Geklöppelte Deckchen und Antiquitäten in den Ecken schmücken das Domizil der alten Dame, die von Periček täglich 24 Stunden betreut wird. Deshalb kann Periček auch während unseres Gesprächs nirgends hin gehen. „Ich habe keine Pause”, entschuldigt sie sich und so bleibt die alte Dame sitzen und hört beim Interview zu, nachdem sie sich erst ein paar Mal vergewissert hat, dass ich sicherlich nicht zu ihr will.
Kein Geld für die Studierenden
Periček kommt aus Kroatien und kommt seit zwei Jahren alle zwei Wochen für zwei Wochen nach Österreich, um als 24-Stunden-Betreuerin zu arbeiten. Sie habe lange überlegt, ob sie herkommen sollte, sagt sie, aber als ihre Kinder zu studieren begannen, blieb ihr nichts mehr anderes übrig. „Meine Kinder haben gute Noten”, sagt sie. „Sie studieren gratis, aber wohnen, essen, das kostet.” In Kroatien gibt es keine Unterstützung für Kinder über 18 Jahre, sodass Periček in ihrem Heimatland kein Geld für ihre drei erwachsenen Kinder bekommen würde, auch wenn diese noch studieren und nichts verdienen. Durch die Arbeit in Österreich aber erhält sie monatlich fast 400 Euro Familienbeihilfe und das mache es schon leichter, sagt sie.
„Das Kindergeld macht vieles einfacher.“
Auf die Frage, ob sie noch hier arbeiten würde, wenn die Kinderbeihilfe weg wäre, schüttelt sie den Kopf. Der Verdienst in Österreich sei zwar besser als in Kroatien, aber der Unterschied sei nicht so groß, dass es sich auszahlen würde. „Viele sind wegen dem Kindergeld da”, sagt sie und fügt hinzu, dass es ohne die Familienbeihilfe viel schwieriger wäre. Natürlich würde sie ihren Kindern dennoch das Studium ermöglichen, müsste das dann aber vom eigenen Lohn bezahlen.
Nur fair?
Die Familienbeihilfe an die Lebenserhaltungskosten der umliegenden EU-Länder anzupassen, sei nur gerecht, argumentiert man in der Regierung. Tatsächlich aber sind etwa Lebensmittel in Kroatien zum Teil sogar teurer als in Österreich. Sie habe die Sachen für die Babys, Windeln und Ähnliches früher immer in Österreich gekauft, meint Periček, auch das sei schlicht billiger gewesen. Von Fairness zu sprechen, ist also schwierig, vor allem Angesichts der Tatsache, dass Pflegerinnen wie Periček Sozialversicherung in Österreich bezahlen.
In diesem Zusammenhang wird seitens der Regierung auch vom Missbrauch des Kindergeldes gesprochen, so wird angeblich Kindergeld für Kinder, die gar nicht existieren, bezogen. Periček runzelt nur die Stirn, als sie das hört. Sie könne sich nicht vorstellen, dass jemand so etwas tun würde und beschreibt den weiten Weg, den ihr Antrag bei den kroatischen Behörden zurücklegen musste, ehe sie wirklich die Beihilfe erhielt. Sie habe erst gar nicht geglaubt, dass sie das Geld wirklich bekomme, meint Periček. Inzwischen ist das Kindergeld aus ihrem Leben kaum noch wegzudenken.
„Das bisschen Missbrauch sind Peanuts”
Auch Martin Stummer, der seit fünf Jahren eine Vermittlungsagentur für Personenbetreuerinnen im Annenviertel führt, betont, dass von Gerechtigkeit nicht die Rede sein kann. Seine Pflegekräfte stammen aus Bulgarien, dem Heimatland seiner Frau, doch auch dort sind die Lebenserhaltungskosten nicht niedriger als ins Österreich. Bei einem Durchschnittseinkommen von 300 bis 400 Euro seien die Preise für Lebensmittel und Sprit fast gleich hoch wie bei uns, sagt er, und das Kindergeld liege zwischen 18 und 25 Euro im Monat. Er räumt jedoch ein, dass es durchaus Fälle gibt, in denen falsche Angaben zu Kindern gemacht würden. „Aber das bisschen Missbrauch sind Peanuts. Wenn es die Kinder gibt, sollen sie gleichwertig unterstützt werden”, sagt er.

Die Auswirkung der Indexierung – sollte sie wirklich eingeführt werden – auf seine eigene Agentur, wären allerdings nicht so groß, schätzt Stummer. Seine Pflegerinnen würden dennoch noch nach Österreich kommen. Von einem Pflegenotstand kann also seiner Meinung nach nicht die Rede sein, auch wenn er betont, dass die Idee, die Pflegeanforderungen ohne Auswärtige zu schaffen, utopisch sei.
Ob er denkt, dass die Regierung mit dem Gesetz auf EU-Ebene durchkommen wird? Das ist, als wolle man von einem Banker wissen, wie die Zinsen der Zukunft aussehen, sagt der Jurist, fügt jedoch hinzu, dass die Regelung in Konflikt mit dem EU-Recht stehe. Klagen der betroffenen Länder seien absehbar, aber ob es zu Nachzahlungen kommen wird, müsse man abwarten. „Worum geht es bei dem Ganzen überhaupt?”, fragt er. Das Geld könne es nicht sein und spätestens wenn die Babyboom-Generation in Pension geht, bräuchte Österreich die Pflegerinnen aus dem Ausland.
“Damit man es besser hat”
Im Herbst wird Brigita Peričeks drittes Kind an die Universität gehen. Stolz erzählt sie, dass ihr Nachwuchs Wirtschaft und Programmieren studiert, um später nach Deutschland oder Österreich zu gehen. Der Schlüssel zu einem guten Leben ist und bleibt die Bildung: “Damit man es später besser hat”, wie Periček sagt. Aber um ihren Kindern eben das zu ermöglichen, braucht Periček die österreichische Familienbeihilfe.
Wenn die Regierung aber Erfolg hat und die Kürzung eintritt, werden Frauen wie Brigita Periček nicht mehr nach Österreich kommen. Wie groß die Folgen tatsächlich sind, lässt sich jedoch nicht absehen. Manche, etwa der steirische Aktivist Klaus Katzianka oder die Grünen, rechnen mit schwerwiegenden Konsequenzen, prophezeien Fachkräftemangel und sprechen gar von “Pflegenotstand.” Andere wie Martin Stummer sehen kein Problem. Sicher ist: Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt stetig und irgendjemand muss sich um sie kümmern.